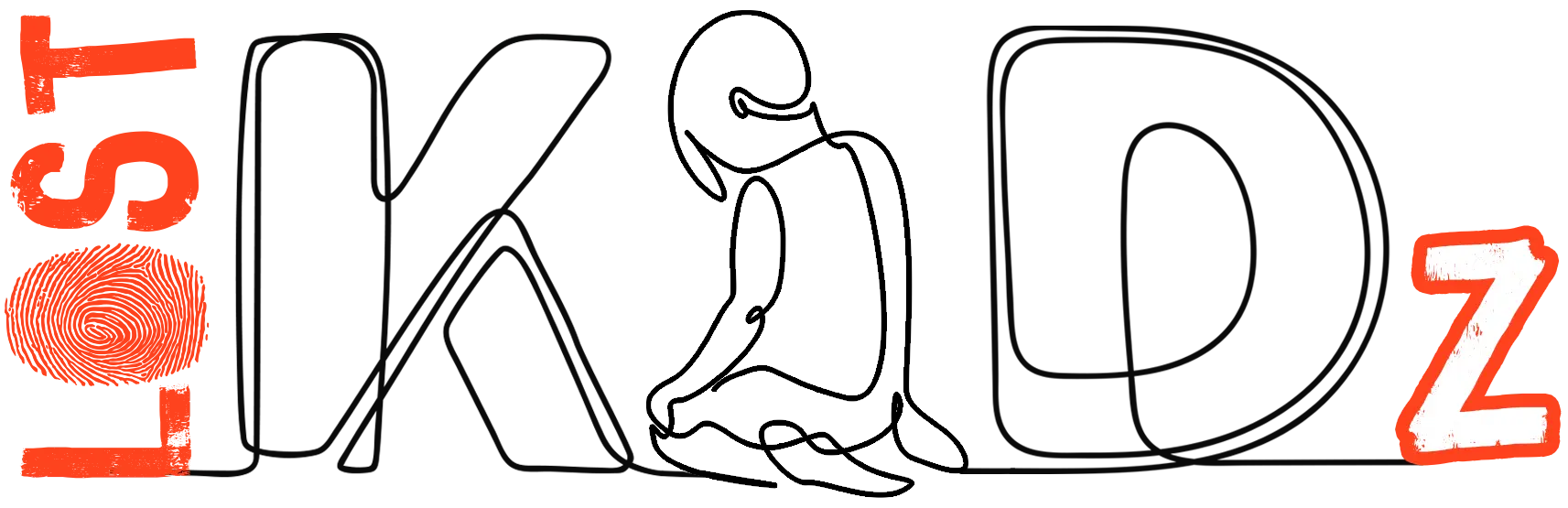Wissenschaft ist sich einig.
Der wissenschaftliche Konsens beschreibt die überdisziplinäre Übereinstimmung darüber, was Kinder für eine gesunde emotionale, soziale und kognitive Entwicklung brauchen. Diese Erkenntnisse stammen aus Jahrzehnten empirischer Forschung – insbesondere aus den Bereichen:
- Entwicklungspsychologie
- Bindungstheorie
- Neurobiologie
Der Staat, seine Institutionen und auch Teile der Gesellschaft verhalten sich in Ländern mit systemisch häufigen Eltern-Kind-Kontaktabbrüchen in einem Widerspruch zum wissenschaftlichen Konsens kindlicher Entwicklung – insbesondere in Bezug auf Bindung, emotionale Sicherheit und seelische Stabilität. Das Verhalten lässt sich wie folgt differenzieren und begründen:
❌ Widerspruch zum Konsens
Obwohl der wissenschaftliche Konsens eindeutig betont, dass dauerhafte Bindungen und regelmäßiger Kontakt zu beiden Elternteilen zentrale Schutzfaktoren für die seelische Gesundheit des Kindes sind, agieren viele Familiengerichte, Jugendämter oder Gutachter:innen im Gegensatz dazu:
- Kontaktabbrüche werden geduldet oder faktisch legitimiert – oft mit Hinweis auf das „Wohl des Kindes“,
- Gerichte entscheiden in Einzelfällen ohne Rücksicht auf den interdisziplinären Stand der Wissenschaft,
- Bindungstheoretisches Wissen wird nicht systematisch vorausgesetzt, weder bei Familienrichter:innen noch bei Jugendamtsmitarbeiter:innen.
⚠️ Beispiel: In Deutschland werden jährlich ca. 60.000 bis 80.000 Kinder durch Trennung dauerhaft von einem Elternteil getrennt – oft ohne ausreichende Begründung oder mit Rückgriff auf veraltete Begriffe wie „Druck auf das Kind“ oder „Erziehungsunfähigkeit“.
⚖️ 2. Institutionen: Funktionalismus statt Entwicklungsschutz
🧩 Institutionelles Verhalten:
- Jugendämter agieren oft interventionistisch, aber nicht entwicklungspsychologisch fundiert.
- Familiensysteme werden nicht als komplexe psychodynamische Beziehungsstrukturen verstanden, sondern funktional verwaltet.
- Familiengerichte setzen häufig auf „Ruhe vor Konflikt“ statt aktiver Bindungssicherung, was zu Bindungsabbruch führen kann.
| Fachdisziplin | Wissenschaftliche Haltung | Institutionelles Verhalten |
|---|---|---|
| Bindungstheorie | Bindungen sind lebenslang prägend | Trennung ohne tragfähige Alternativen |
| Entwicklungspsychologie | Kontaktabbrüche gefährden Reifung | Kontakt wird als optional behandelt |
| Neurobiologie | Stress und Trennung aktivieren Trauma-Systeme | Institutionen reagieren „symptomatisch“ statt präventiv |
🧑🤝🧑 3. Gesellschaft: Passivität und Mythen
Die breite Gesellschaft zeigt häufig:
- Passivität, da innerfamiliäre Dynamiken als „privat“ gelten,
- Mythen über Trennung (z. B. „Kinder gewöhnen sich schon daran“),
- Misstrauen gegenüber entfremdeten Elternteilen, vor allem Vätern.
📉 Studienlage:
- In Ländern wie Deutschland, Österreich, Frankreich oder auch Teilen der USA ist der Begriff der „elterlichen Entfremdung“ gesellschaftlich und juristisch nicht konsensfähig, obwohl psychologische Forschung die langfristigen Schäden dokumentiert.
🔬 Widerspruch als strukturelles Problem
| Bereich | Konsens der Forschung | Verhalten in Praxis |
|---|---|---|
| Rechtsprechung | Kontaktabbrüche vermeiden, Bindung sichern | Umgangssperren, kein Zwang zur Kooperation |
| Jugendhilfe | Unterstützung bei Beziehungspflege | Fokus auf Konfliktvermeidung statt Bindungserhalt |
| Öffentlichkeit | Aufklärung über kindliche Bedürfnisse | Ignoranz oder Täter-Opfer-Umkehr |
| Gesetzgebung | Kindeswohl als dynamisches Beziehungsmodell | Kindeswohl rechtlich oft auf „Ruhen vor Streit“ reduziert |
📚 Begründung des Widerspruchs
🔍 Mögliche Ursachen:
- Rechtspositivismus: Gerichte urteilen nicht nach psychosozialem Verständnis.
- Fehlende transdisziplinäre Ausbildung bei Richter:innen, Gutachter:innen, Jugendämtern.
- Systemerhalt vor Kindesschutz: Institutionen vermeiden Eskalation, nicht Entwicklungsrisiken.
- Machtasymmetrien: Ein Elternteil (oft der betreuende) kann durch Deutungshoheit Kontakt verhindern.
- Genderrollen und Vorurteile: Väter gelten häufiger als verzichtbar, Mütter als per se bindungssicher.
📊 Wirkungen dieser Missachtung:
Langfristige Schäden bei betroffenen Kindern:
- Bindungsstörungen
- Depression, Angststörungen
- Selbstwertdefizite, Identitätskrisen
- Langfristig höhere Suizid- und Psychoseraten (Quelle: Bruchhaus & Rücker, 2020)
✅ Fazit
Der wissenschaftliche Konsens fordert dauerhafte, sichere Beziehungen, emotionale Co-Regulation und Vermeidung von Kontaktabbrüchen.
Der Staat, Institutionen und Gesellschaft missachten oder unterlaufen diesen Konsens regelmäßig – meist aus funktionalen, strukturellen oder ideologischen Gründen, nicht aus bloßer Unkenntnis.